Aktuell
DX
Funkwetter
Wir befinden uns im Solarzyklus 25.
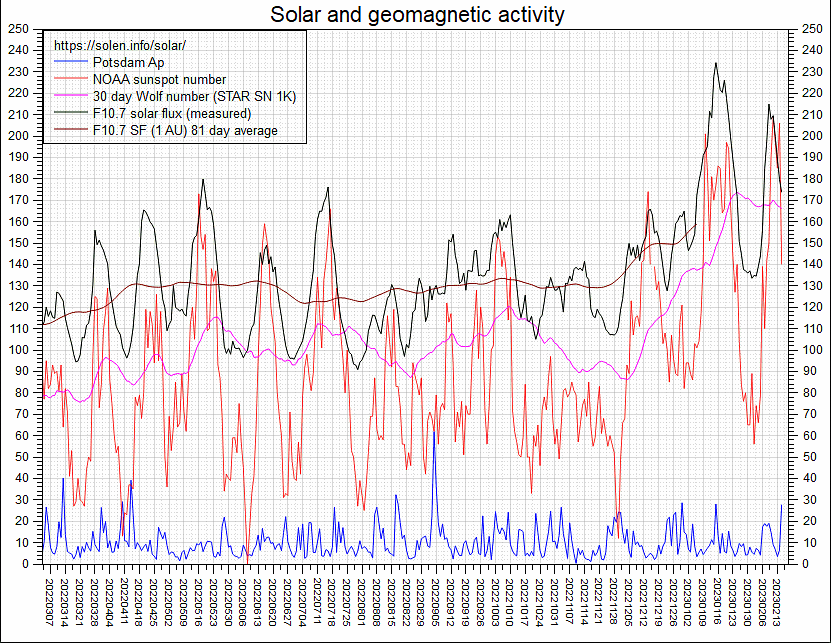
(zur Aktualisierung auf Bild klicken)
Funkwetterbericht vom 9. Januar 2024
Quelle: DARC (Deutschlandrundspruch)
Autor: Hartmut Büttig, DL1VDL
![]()
Rückblick vom 2. bis 9. Januar:
Das heutige Magnetogramm von der Sonne zeigt neun Sonnenfleckenregionen. Im Berichtszeitraum wurden über 150 C-Flares und drei M-Flares registriert. Der im Dreistundentakt bestimmte geomagnetische Index k lag immer zwischen Null und drei, was ein ruhiges Erdmagnetfeld charakterisierte. Trotz der kurzen Sonneneinstrahlung in der nördlichen Hemisphäre erreichte die für 3000 km Sprungentfernung geltende Grenzfrequenz der F2-Schicht hohe Werte. Sie betrug nachts etwa 8 MHz, bei Sonnenaufgang bereits 18 MHz, zwei Stunden später 35 MHz, mittags ebenso, bei Sonnenuntergang 26 MHz und zwei Stunden später noch 11 MHz [9]. Morgens waren Stationen aus ZL bei der relativ kurzen Überlappung von Sonnenaufgang in DL und Sonnenuntergang in ZL täglich auf den Bändern zwischen 40 und 10 m zu hören. Die parallel zum Äquator verlaufenden Funkwege funktionierten am zuverlässigsten. Ab Sonnenaufgang in Nordamerika dominierten laute Signale von dort zwischen 20 und 10 m. Bei ruhiger Geomagnetik war nachmittags die US-Westküste über den langen Weg auf 40 m auch mit 100 W und Dipolantenne zu erreichen. Als im CW-QSO mit N7XM, von DL1VDL unbemerkt, seine Transistor-PA mit SWR-Fehler abschaltete, konnte OM Josh das 30-W-Treibersignal noch lesen.
Vorhersage bis 16. Januar:
Sechs Sonnenfleckenregionen befinden sich bereits westlich des Zentralmeridians der Sonne [10]. Flares von der komplexen Ragion 3536 könnten in den nächsten Tagen die Erde treffen. Die Wahrscheinlichkeit für M-Flares beträgt heute 45 Prozent. Wir erwarten etwa gleichbleibende Fluxwerte bei 155 Einheiten und ein überwiegend ruhiges Erdmagnetfeld. Nicht vorhersagbare Flares können natürlich unerwartete Störungen und Mögel-Dellinger- Effekte auslösen. Die Ionosphäre und damit auch die Grenzfrequenz der F2-Schicht bleiben so gut wie in der Vorwoche.
[9] https://lgdc.uml.edu/common/DIDBYearListForStation?ursiCode=JR055
[10] https://www.solen.info/solar/
Links zum Thema:
- https://www.wimo.com/de/sonnenflecken
- https://www.solarham.net
- Verlauf Solarzyklus 25
- https://www.swpc.noaa.gov/news/noaa-forecasts-quicker-stronger-peak-solar-activity
- Aktueller Funkwetterbericht von DL1VDL